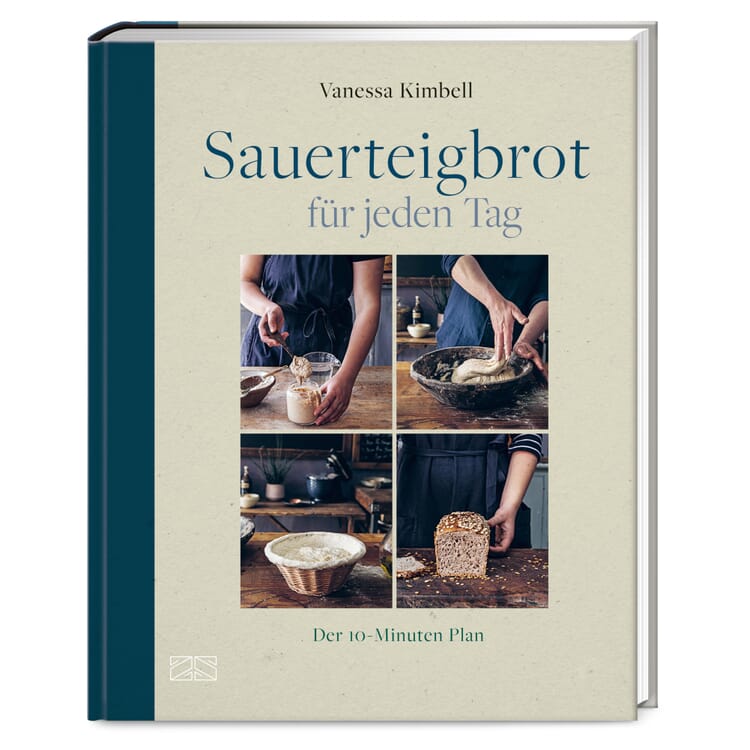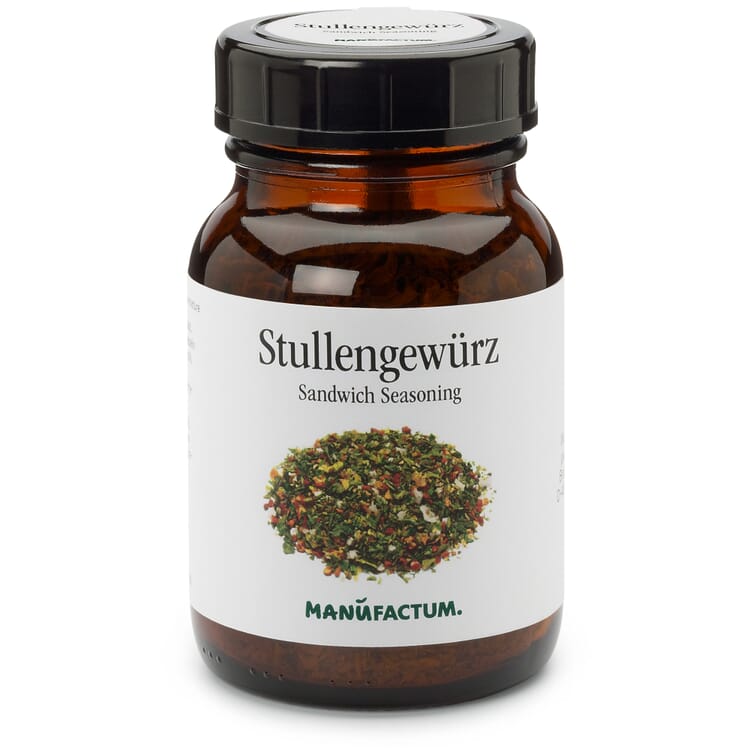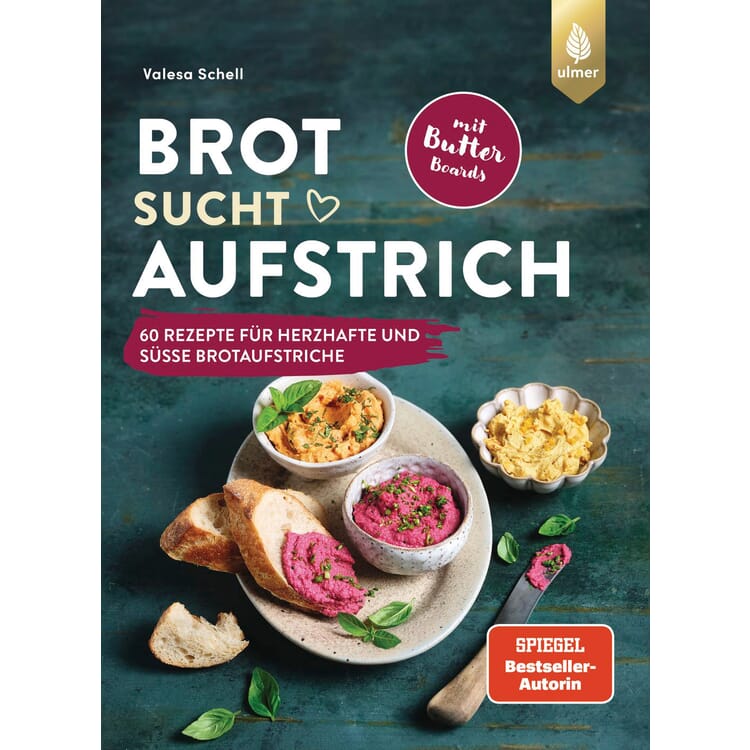Ratgeber
Backen mit Sauerteig
Brot essen ist keine Kunst, aber Brot backen. So lautet ein deutsches Sprichwort. Brot backen mit Sauerteig – das ist nichts für Brotbackanfänger*innen, behaupten manche. Das sehen wir völlig anders und sagen stattdessen lieber: immer ran ans Anstellgut! Denn wir sind überzeugt: Haben Sie es ein, zwei, drei Mal ausprobiert, werden Sie erstens die Freude am Brotbacken und den Genuss selbst gebackenen Brotes entdecken, und zweitens wissen Sie viel besser als vorher, woran Sie qualitätvolles Brot erkennen.
Gutes Brot braucht gute Zutaten, denn die Qualität der Zutaten entscheidet maßgeblich über den Geschmack. Gutes Brot braucht außerdem nur wenige Zutaten, als da wären: vermahlenes Getreide, Wasser, Salz, Zeit, Sauerteig. Die Wassermenge wirkt auf die Textur des Teiges ein, und das im Teig gebundene Wasser beeinflusst, wie lange das gebackene Brot frisch bleibt. Salz macht den Teig dehnbarer und stabiler, es sorgt für eine schönere Krustenbräunung und verleiht dem fertigen Brot bessere Kaueigenschaften. Zeit spielt als Zutat eine ebenso wichtige Rolle, denn Zeit fördert Geschmack, Aroma und Verträglichkeit (und macht Backmittel und Zusätze überflüssig). In den Ruhephasen laufen diverse Schlüsselprozesse ab, die über das gute Gelingen eines Brotes entscheiden, beispielsweise (kurz zusammengefasst) der biologische Aufschluss der Mehlbestandteile durch getreideeigene Enzyme, die Bildung von Milch- und Essigsäure, die optimale Wasserverquellung und die Vermehrung der Hefen. Sauerteig schließlich ist ein aktiver Teig, der sich in Vergärung befindet. Apropos Vermehrung der Hefen: Während der Sauerteigreife werden wilde Hefen vermehrt, Säure und Aromastoffe gebildet, und Wasser wird gebunden. Dank einem äußerst komplexen Zusammenspiel von Mikroorganismen kann ein Sauerteig je nach herrschenden Bedingungen nachweislich mehr als 300 Aromen produzieren.
Sauerteig selbst machen
Sauerteig, das komplexe Wesen? Ja – und nein. Mit ein paar Tricks und Kniffen gelingen Ansetzen und Pflege von Sauerteig auch in der heimischen Küche. Sauerteig macht Brot bekömmlicher. Er sorgt dafür, dass sich das Brot deutlich länger frisch hält, und beugt Schimmelbildung vor. Und er verbessert die Backeigenschaften von backstarken Mehlen – nicht nur von Roggenmehl, sondern auch von Dinkel- und Weizenmehl.
Natursauerteig ist kein Selbstläufer. Der erste Sauerteigansatz gelingt nicht automatisch, ein wenig Glück gehört immer dazu. Sie können Ihrem Backglück auf die Sprünge helfen, indem Sie Vollkornmehl anstelle von Auszugsmehl (Type 405) verwenden. Denn Vollkornmehl besitzt den größten Anteil an Getreidekorn-Schalen, und an eben diesen Schalen leben unter anderem Milchsäurebakterien und Hefen – unsere natürlichen Helfer. Zu einem Teil Vollkornmehl (50 g) gesellt sich ein Teil warmes Wasser (50 g), beides verrühren Sie zu einer im besten Fall mörtelähnlichen Masse. Unser Tipp: Reiben Sie einen Bio-Apfel samt Schale sehr fein, pressen Sie den Saft aus und verwenden Sie diesen anstelle von Wasser. So lässt sich die Zahl der Mikroorganismen im Sauerteigansatz mit einfachen Mitteln erhöhen. Nun heißt es warten, bis die ersten kleinen Bläschen zu sehen sind und sich der Teigansatz vergrößert. Stellen Sie Ihren Teig mindestens in den ersten drei Tagen warm, zum Beispiel in den Backofen bei eingeschaltetem Licht (später reicht Raumtemperatur aus), und denken Sie daran, ihn weiterhin einmal täglich zu „füttern“. An Tag zwei, drei, vier und fünf frischen Sie Ihren Sauerteig in folgendem Mischungsverhältnis an: Zu 100 g reifem Teig kommen 100 g Mehl und 100 g Wasser. Woran Sie übrigens gut erkennen können, dass Ihr Sauerteig Appetit hat: Er fällt an der Oberfläche ein. Wenn dies geschieht, haben die eingefangenen Mikroorganismen den gesamten Mehlvorrat verstoffwechselt und benötigen Nachschub. Falls Ihnen die Mengen über den Kopf wachsen, können Sie etwa am dritten Tag dazu übergehen, eine kleinere Portion Sauerteig weiter anzufrischen: Auf 25 g Sauerteig geben Sie dann nur noch halb so viel Mehl und Wasser (je 50 g). Überschüssigen reifen Teig können Sie direkt zum Backen verwenden. Machen Sie die Geruchsprobe: Reifer Sauerteig riecht angenehm fruchtig säuerlich (wie Joghurt) und schmeckt auch so.
Reifer Sauerteig als Anstellgut hält sich im Kühlschrank im Grunde genommen ein Leben lang, wenn er die richtige Pflege erfährt. Bei niedrigen Temperaturen ist Ihr Sauerteig deutlich weniger produktiv, da die enthaltenen Mikroorganismen langsamer arbeiten. Daher kann es schon genügen, das „Füttern“ auf einmal in der Woche zu einem festen Zeitpunkt zu reduzieren (sonntags vor dem Tatort, freitags nach Feierabend, um das Wochenende einzuläuten, montagmorgens, weil die Arbeitswoche dann gleich mit guten Aussichten auf köstliches Backwerk beginnt). So können Sie sich jederzeit an Ihrem Sauerteig bedienen– er ist immer einsatzbereit. Bedenken Sie aber, dass er umso aktiver ist, je weniger Zeit zwischen dem letzten Anfrischen und dem Backen vergeht. Das ist gut! Wenn Sie also am Freitag einen Teig für Brot oder Brötchen, Zimtschnecken, Pizza oder Focaccia ansetzen möchten, „füttern“ Sie Ihren Sauerteig am Donnerstag zusätzlich zur üblichen Routine. Übrigens: Ihr Sauerteig verdirbt nicht, wenn er einmal zwei, drei Wochen in der Kühlung vergessen wird. Nur zum Backen ist er dann nicht geeignet und benötigt mehrere Anfrischungen hintereinander, bis er wieder einsatzfähig ist. Hinweis: Nehmen Sie zum Anfrischen am besten das Mehl, das Sie auch zum Backen bevorzugen (es muss kein Vollkornmehl mehr sein). Arbeiten Sie immer mit sauberen Materialien und spülen Sie Geschirr und Löffel vor dem Kontakt mit Ihrem Sauerteig mit heißem Wasser ab. Dran denken: zu jedem Anfrischen auch ein frisches Gefäß!
Weitere Themen
Das Besondere an unseren Manufactum Backstuben ist nicht nur die gläserne Außenfassade, durch die Sie unseren Bäcker*innen ganz transparent bei jedem ihrer Arbeitsschritte zuschauen können. Schließlich zählt beim Brot vor allem eines: der Geschmack. Und ausschlaggebend dafür sind die Zutaten. Seine schöne Kruste bekommt das Brot im Tuffsteinofen, in dem genau die Röststoffe entstehen, die den Geschmack wesentlich mitprägen. Wir backen die Laibe daher möglichst dunkel aus.
Jetzt entdecken